Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat in einem wegweisenden Urteil entschieden, dass betroffene Personen keinen Anspruch darauf haben, dass eine Wirtschaftsauskunftei ihre Bonität weiterhin durch Scoring bewertet und die entsprechenden Werte an Dritte weitergibt. Damit bestätigt das Gericht die Rechtmäßigkeit sogenannter Scoresperren, die eine Auskunftei verhängen kann, wenn ein Betroffener gegen die Verarbeitung seiner Daten vorgeht.
Hintergrund des Falls
Die Klägerin ist eine Person, die gegen eine Wirtschaftsauskunftei im Hauptsacheverfahren vor dem Landgericht Münster geklagt hatte. In diesem Verfahren argumentierte sie, dass die Ermittlung und Übermittlung von Scorewerten gegen datenschutzrechtliche Vorschriften verstoße und forderte die Unterlassung dieser Praxis. In Reaktion darauf entschied sich die Auskunftei, die Berechnung und Mitteilung des Scorewerts für die Klägerin vollständig einzustellen (Scoresperre). Dies führte dazu, dass bei Anfragen von Vertragspartnern der Wirtschaftsauskunftei keine Scorewerte mehr übermittelt wurden.
Interessanterweise änderte die Klägerin daraufhin ihre Position und verlangte nun, dass die Auskunftei ihre Daten wieder verarbeitet und Scorewerte ermittelt sowie an Dritte weiterleitet. Diesen Antrag stellte sie im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens vor dem Landgericht Wiesbaden, welches den Antrag jedoch ablehnte. In der Berufung bestätigte das OLG Frankfurt diese Entscheidung.
Kein Anspruch auf Scoring durch Wirtschaftsauskunfteien
Das OLG Frankfurt stellte klar, dass es keine gesetzliche Grundlage gibt, die einen Anspruch auf Durchführung des Scorings begründet. Die Betroffenenrechte der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) gewähren Personen zwar weitreichende Möglichkeiten, etwa die Berichtigung falscher Daten (Art. 16 DS-GVO), das Löschen von Daten (Art. 17 DS-GVO) oder eine Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) zu verlangen. Allerdings besteht kein Anspruch darauf, dass eine Wirtschaftsauskunftei die Bonität einer Person aktiv bewertet und diese Bewertung an Dritte weitergibt.
Das Gericht betonte, dass eine Datenverarbeitung grundsätzlich freiwillig erfolgt und es allein in der Hand der verantwortlichen Stelle liegt, ob sie eine Verarbeitung vornimmt oder nicht. Dies ergibt sich auch aus dem datenschutzrechtlichen Grundsatz der Datenminimierung (Art. 5 Abs. 1 lit. c DS-GVO), der darauf abzielt, dass personenbezogene Daten nur verarbeitet werden, wenn dies tatsächlich erforderlich ist.
Keine Persönlichkeitsrechtsverletzung durch die Nicht-Berechnung eines Scorewerts
Die Klägerin argumentierte, dass die Verweigerung der Berechnung eines Scorewerts sie wirtschaftlich benachteilige und somit ihr allgemeines Persönlichkeitsrecht verletze. Das OLG Frankfurt widersprach dem deutlich:
• Die Mitteilung, dass kein Scorewert berechnet wird, ist keine negative Bewertung der betroffenen Person. Es handle sich nicht um eine Äußerung über die Bonität oder wirtschaftlichen Verhältnisse der Person, sondern lediglich um eine Nicht-Äußerung.
• Da keine entstellenden oder verfälschenden Angaben über die Klägerin gemacht wurden, liegt keine Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts vor.
• Auch die Information gegenüber Dritten, dass kein Scorewert verfügbar ist, ergebe keinen Rückschluss auf eine schlechte Bonität.
Widersprüchliches Verhalten der Klägerin – Rechtsmissbrauch nach § 242 BGB
Besonders bemerkenswert ist, dass das OLG Frankfurt darauf hinwies, dass sich die Klägerin durch ihr Verhalten in Widerspruch zu ihrem eigenen Vorbringen im Hauptsacheverfahren setzt. Während sie dort geltend machte, dass die Scoreberechnung datenschutzwidrig sei, verlangte sie nun deren Fortsetzung.
Ein solches Verhalten kann als “venire contra factum proprium” gewertet werden – ein Rechtsgrundsatz, der besagt, dass sich jemand nicht auf eine rechtliche Position berufen kann, wenn er zuvor das genaue Gegenteil gefordert hat. Nach § 242 BGB kann ein solches widersprüchliches Verhalten als treuwidrig und rechtsmissbräuchlich angesehen werden.
Das Gericht stellte deshalb klar, dass eine Wirtschaftsauskunftei nicht gezwungen werden kann, eine Datenverarbeitung fortzusetzen, die zuvor von der betroffenen Person selbst als unzulässig bezeichnet wurde.
Verzicht auf Schadensersatz als Bedingung für eine Wiederaufnahme der Score-Berechnung
Ein weiteres interessantes Detail des Urteils ist die Frage, ob eine Wiederaufnahme der Scoring-Verfahren davon abhängig gemacht werden kann, dass der Betroffene auf etwaige Schadensersatzansprüche verzichtet. Das OLG deutete an, dass dies eine rechtlich zulässige Lösung sein könnte, um das Problem widersprüchlicher Anträge zu lösen.
Fazit
Das Urteil des OLG Frankfurt hat große Bedeutung für den Umgang mit Scoresperren und unterstreicht mehrere wesentliche Grundsätze:
1. Kein Anspruch auf Scoring:
• Betroffene Personen haben keinen Anspruch darauf, dass eine Wirtschaftsauskunftei ihre Bonität bewertet und Scorewerte an Dritte übermittelt.
• Die Datenschutz-Grundverordnung enthält keine Grundlage für eine solche Forderung.
2. Keine Persönlichkeitsrechtsverletzung:
• Die Tatsache, dass kein Scorewert berechnet wird, bedeutet keine negative Bewertung.
• Wirtschaftsauskunfteien enthalten sich in solchen Fällen schlicht einer Äußerung über die betroffene Person.
3. Rechtsmissbrauch durch widersprüchliches Verhalten:
• Wer einerseits gegen eine Datenverarbeitung klagt, kann nicht gleichzeitig deren Fortsetzung verlangen.
• Ein solches Verhalten kann nach § 242 BGB als rechtsmissbräuchlich gewertet werden.
4. Schutz der Wirtschaftsauskunfteien:
• Wirtschaftsauskunfteien dürfen selbst entscheiden, ob sie personenbezogene Daten verarbeiten oder nicht.
• Falls eine Person eine Datenverarbeitung ablehnt, ist die Wirtschaftsauskunftei berechtigt, die Verarbeitung dauerhaft einzustellen. Dieses Urteil hat weitreichende Auswirkungen auf die Praxis von Wirtschaftsauskunfteien und dürfte zukünftige Rechtsstreitigkeiten über die Rechtmäßigkeit von Scoringverfahren erheblich beeinflussen.
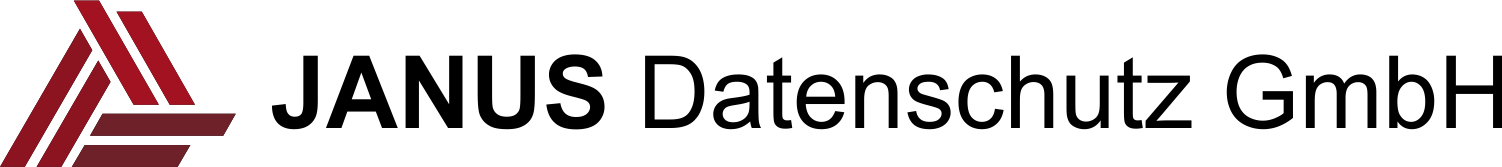



Neueste Kommentare